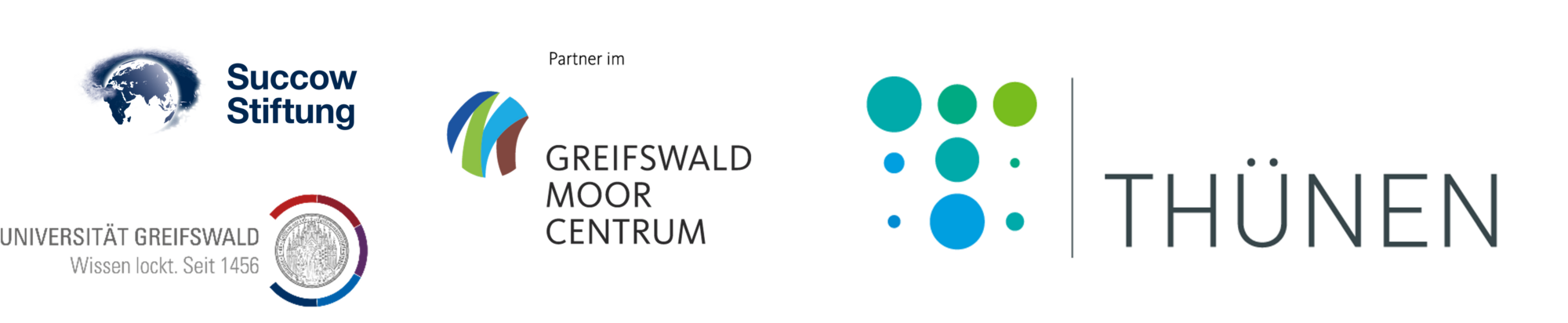Treibhausgase
Hintergrund
Forschungsergebnisse aus wiedervernässten Mooren zeigen, dass die Einstellung von oberflächennahen Wasserständen zu einem deutlichen Rückgang der CO2- und N2O-Emissionen führt und dass mit Etablierung torfbildender Vegetation häufig auch eine C-Senke erreicht werden kann. Die CH4-Emissionen nehmen nach Wiedervernässung dagegen zu, wobei die Höhe der CH4-Emissionen von Standortsbedingungen wie Vegetation, Produktivität und Wasserstand abhängt. Insgesamt führt Wiedervernässung zu einer deutlichen Minderung der THG-Emissionen. Die wenigen für Paludikulturen vorliegenden Studien bestätigen das Reduktionspotential, stammen aber nur für Torfmoosanbau aus einer richtigen Paludikultur. Veröffentlichungen zum möglichen Einfluss der Bewirtschaftung nasser Niedermoore dagegen basieren bisher auf THG-Messungen experimentell gemähter Plots. Die Datengrundlage zum Emissionsreduktionspotential von Paludikulturen ist also noch sehr dünn. Da von der flächenhaften Umstellung auf Paludikultur ein wesentlicher Beitrag für den Klimaschutz erwartet wird ist es notwendig, die Datenlage so zu verbessern, dass daraus bundesweit übertragbare Aussagen zu potentiellen Emissionsreduktion durch Paludikultur abgeleitet werden können. Um das zu erreichen, müssen die THG-Emissionen wichtiger Paludikulturen unter Praxisbedingungen im Vergleich zu weiterhin entwässerten Referenzen nach internationalen Standards und mit über alle PaludiNetz-Projekte hinweg vergleichbaren Methoden erfasst und wichtige Fragen insbesondere zum Einfluss von Standortfaktoren, Paludikultur, Wassermanagement und Bewirtschaftung auf Torfbildung und THG-Emission beantwortet werden.
Ziele
Unser Ziel besteht darin, die standortspezifischen THG-Messungen zu harmonisieren, insbesondere die Instrumentierung, Datenerfassung und Datenprozessierung, die PaludiNetz-Projekte bei allen Fragen zu Messungen und Auswertungen zu unterstützen und dann gemeinsam mit ihnen übergreifende Datensynthesen durchzuführen.
Durch die Abstimmung und Festlegung von Standards und Setups für Datenerfassung und Qualitätssicherung werden methodische Unsicherheiten reduziert und die Vergleichbarkeit der Daten zwischen den Projekten gewährleistet, was wesentlich für die Synthesearbeiten ist. Die Synthesen erhöhen die Sichtbarkeit der in den Projekten gewonnenen Daten und ermöglichen es, bundesweite Aussagen zum THG-Minderungspotential durch Umstellung auf nasse Bewirtschaftung zu erarbeiten und Optimierungsmöglichkeiten bei der Bewirtschaftung von Paludikulturen im Hinblick auf den Klimaschutz zu identifizieren.
Methoden
Die CO2- und CH4-Flüsse auf den Paludikulturflächen werden mit der Eddy-Covariance (EC)-Methode gemessen. Diese erfasst die Flüsse eines bestimmten Flächenausschnitts („footprint“) in hoher zeitlicher Dynamik und kann neben der CO2-Dynamik auch die an nassen Standorten mit Helophyten oft ausgeprägten CH4-Tagesgänge gut abbilden. Die MuD- und einige Pilotvorhaben untersuchen außerdem die THG-Emissionen trockener Referenzflächen. Für die CO2-Flüsse kommt dort ebenfalls die EC-Methode zum Einsatz, für die dort weniger dynamischen CH4- und N2O-Flüsse die Hauben-Methode. Die THG-Bilanzen hängen zusätzlich zum gasförmigen Austausch auch von den lateralen Flüssen, insbesondere den Kohlenstoffexporten mit der Ernte und -importen mit organischem Dünger ab.
Um ein einheitliches Vorgehen der Projekte bei der Erfassung der THG-Flüsse zu erreichen, tauschen wir uns in der AG-THG regelmäßig aus, stimmen Setups, Protokolle und Berechnungsroutinen ab und diskutieren Zwischenergebnisse.
Für die EC-Messungen orientieren wir uns an den Standards der internationalen Forschungsinfrastruktur ICOS (Integrated Carbon Observation System). Wir beraten bei Auswahl und Instrumentierung der EC-Standorte, besuchen Messstandorte, unterstützen bei der Datenprozessierung und stellen Skripte dafür bereit.
Für die Haubenmethode ist die Standardisierung weniger weit fortgeschritten und werden wir Messdesign, Flussberechnung und Qualitätsprüfung mit den Projekten abstimmen.
Zur Erfassung der lateralen Flüsse entwickeln wir in der AG-THG teilweise neue Methoden und Protokolle, die auf Erfahrungen aus der AG und internationalen Empfehlungen aufbauen und sich an den konkreten Voraussetzungen der Projektgebiete orientieren. Ziel ist eine vergleichbare Erfassung des C-Exports durch Ernte und Beweidung und des C-Imports mit organischem Dünger. Zur Bestimmung der Wuchshöhe der Vegetation wurde in AP3 ein Herbometer entwickelt und den Projekten verfügbar gemacht. Damit kann die Vegetationshöhe relativ schnell an einer großen Anzahl von Punkten erfasst und so die an weniger Punkten ermittelte Biomasse auf den gesamten EC footprint hochgerechnet werden.
Projektübergreifend wird in AP3 das Torfbildungspotential als Proxy für Torfbildung und THG-Bilanzen entwickelt. Das Torfbildungspotential ist die Differenz zwischen dem Biomasseaufbau und -abbau im Torf und wird z.B. mit Ingrowth Cores (zur Bestimmung des Biomasseaufbaus durch Wurzeln und Rhizome) und Litterbags (zur Bestimmung des Biomasseabbaus) ermittelt. Das Torfbildungspotentials soll im PaludiNetz auf den verschiedenen Paludikulturen und Moortypen durch Vergleich mit den gemessenen THG-Bilanzen als Proxy etabliert werden, um diesen dann auch für das Monitoring von Paludikulturflächen über das PaludiNetz hinaus anwenden zu können.